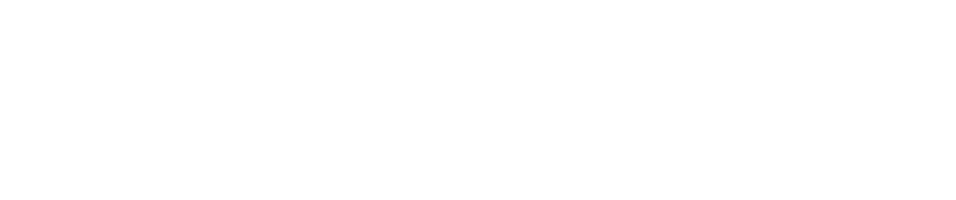Deutsche Regeln über Bord: Überleben in der asiatischen Megacity
Wenn ein Kind in einer deutschen Kleinstadt lernt eine Straße zu überqueren, lautet die Regel: Man schaut nach rechts, links, rechts; es kommt nichts; man geht los. So lernten auch wir, Silke und Susan, die Verkehrsregeln in den sächsischen Kleinstädten Meerane und Hartmannsdorf. Nie hätten wir zu träumen gewagt, dass uns solch ein fast schon unbewusster Akt der Selbstverständlichkeit im Straßenverkehr im Erwachsenenalter den Schweiß auf die Stirn treiben würde. Aber im damaligen Trabant-geprägten Verkehr wussten wir auch noch nicht, dass wir beide später in unterschiedlichen Großstädten der Welt auf die Flexibilitätsprobe (der Straßenüberquerung und Weltenwanderung) gestellt werden würden.
Während Susan im stundenlangen Stau in der chinesischen Hauptstadt Peking und der Nachbarstadt Tianjin graue Haare wuchsen, wuselte sich Silke durch die atemberaubend langen, chaotischen Schlangen von Autos, Motorrädern und Mopeds der südostasiatischen Riesenmetropole Jakarta. Ein Sprung von ein paar tausend Einwohnern zu zweistelligen Millionenzahlen – Jakartas Metropolregion schafft es auf knapp 30 Millionen Einwohner (Stand 2010), während die Megacity Peking 21.5 Millionen (Stand 2016) Menschen verbuchen kann. An die deutschen Regeln für Ordnung und Sicherheit schien sich da keiner so richtig zu halten.
“Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit den ersten Schritt” – Laotse
In meinem Fall (Susan) war der erste Schritt in China jedoch ein schwieriger. Ich konnte nämlich aufgrund der Luftverschmutzung weder die Gebäude auf der anderen Straßenseite des Hotels sehen, noch irgendwo eine Ampel entdecken, die mir das Überqueren der sechsspurigen Straße voller Autos ermöglicht hätte. Zurück im Hotel sackte ich samt meinem 7-monatigen Babybauch in den Lobbysessel und wusste nicht mehr weiter. Das war ja nun nicht das erste Mal, dass ich mit Neugierde und Entdeckerdrang in ein neues Land zog. Nach Jahren in den USA, Australien und Dänemark überraschte mich mein Mangel an Flexibilität. Ich versuchte mich zu erinnern, wie ich in anderen Situationen mit dem ersten Schock umgegangen war. Beobachten, fragen und anpassen, war also mal wieder das Motto.
Schon einige Monate später pirschte ich mit quietschenden Kinderwagenreifen im Slalom über die Autobahn. Ich hatte ja keine Wahl. Und es machte auch Spaß, von den chinesischen Autofahrern angeregt angehupt zu werden. Ob es Beifall oder Ärger war, ich werde es nie herausfinden.
Der Verkehr an sich war für mich auch eine klare Metapher zur Kultur, die ich weiter kennenlernen wollte. Während ich aus Deutschland gewohnt war, Regeln und gesetzten Strukturen zu folgen, wurden diese hier stets aufs Neue ausgehandelt. Es war faszinierend, dieses lebendige, organische und für mich unstrukturierte Gewusel an sich kreuzenden Autos, Fahrrädern und beladenen Mopeds zu beobachten.

Je mehr ich verstand und über das Land erfuhr, desto weniger klar war mein Bild über “die Chinesen”. Es gab so viele Nuancen und Unterschiede innerhalb dieses großen Landes, sei es beim Dialekt, beim Aussehen, bei der Religion, oder beim Essen. Hühnchen Süß-Sauer war, wie ich schnell herausfand, kein Nationalgericht.
Das Essen war in China sowohl Highlight als auch große Herausforderung an meine Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Wie weltgewandt und offen für neue Dinge man wirklich ist, lässt sich schnell feststellen, wenn man an einem Tisch voller unidentifizierbarer Speisen sitzt und der chinesische Gastgeber erst im Nachhinein verrät, dass man sich da gerade Stink- oder Schimmeltofu in den Mund geschoben hat.
Doch während chinesisches Essen ein relativ augenscheinlicher Unterschied zum sächsischen Kleinstadtleben darstellte, waren die subtilen Unterschiede im Verhalten meiner chinesischen Freunde und Kollegen und das Eintauchen in die verschiedensten Subkulturen der Riesenmetropole spannender. Dagegen fühlte sich das Navigieren im chinesischen Verkehrswahnsinn an wie Kinkerlitzchen.
“Wer sich nicht traut zu fragen, wird sich verlaufen.” Indonesisches Sprichwort
Die Frage, die mich, Silke, in den ersten Tagen nach meiner Ankunft in Jakarta hingegen am meisten beschäftigte, war: “Wie sicher ist es denn eigentlich, hier durch die Straßen zu laufen?” Ein Stadtzentrum mit Läden und Fußgängerzone, wie ich es aus europäischen Ländern kannte, gab es nicht. Die Straßen waren breit, unendlich lang und vor allem – voll! Auf den Fußwegen, falls vorhanden, standen mobile Garküchen und Kioske. Davor brummte der Verkehr: Massen an Mopeds knatternden vorbei, dazwischen fuhren ein paar Autos. Busse ohne Türen, dafür aber umgeben von dunklen Abgaswolken, bretterten mit halsbrecherischer Geschwindigkeit dahin. Versuchte ich über eine Straße zu gehen, schnitten mir vermummte Mopedfahrer den Weg ab. Für mich sie sahen aus, als ob sie entweder eine Bank überfallen hatten oder mir meine Tasche entreißen wollten (was – so viel sei hier vorweggenommen – nie passierte).
“Hier läuft der Hase völlig anders”, gestand ich mir schweißtriefend und mit einem Anflug von Verzweiflung nach meiner ersten Erkundungstour ein. Doch forderte mich dieses Chaos heraus: Ich wollte in diesem Hexenkessel von asiatischer Großstadt klarkommen. Ich wollte mich durch dieses Gewusel genauso hindurchschlängeln lernen, wie das die Einheimischen tun.

Also begann ich zu fragen, zu lernen, zu verstehen. Nach ein paar Wochen wusste ich, dass die Tücher um die Köpfe der Mopedfahrer schlichtweg als Atemschutzmaske in der als Big Durian (Große Stinkfrucht) genannten Stadt dienten. Ich lernte, wie man sich ein Taxi ruft und mit welcher Buslinie ich ohne Bedenken durch die Innenstadt kurven konnte. Auch verlor ich nicht mehr die Nerven, wenn mich in den Straßen abhängende Männer “Hello Misterrr!” riefen. Ich gewöhnte mich an die Tatsache, dass die Indonesier einerseits kontaktfreudig sind und ich als große, weiße Frau einfach mal auffiel.
Bald wurde für mich klar: Wenn ich diese Stadt und seine Menschen verstehen wollte, musste ich ihr Leben und ihren Alltag kennenlernen. Und das am besten hautnah. Kurzentschlossen nahm ich daher das Angebot einer jungen Kollegin an, ein freies Zimmer in ihrer indonesischen Mädchen-WG zu beziehen. Eine gute Entscheidung: Auch wenn die gelegentlichen Besuche von Kakerlaken und Ratten mir echt zu schaffen machten, hatte ich dort eine fantastische Zeit! Die jungen Frauen, die aus Kalimantan, Bali oder Sumatra in die Hauptstadt zum Studieren gekommen waren, halfen mir nicht nur indonesische Vokabeln zu lernen und richtig auszusprechen. Sie brachten mir auch bei das beste Sambal (Chillisauce) der Welt zu zaubern und Reisgerichte galant mit den Händen zu essen. Dank ihnen lernte ich mehr und mehr flexibel zwischen Sprachen, kulinarischen Standards, kulturellen Gewohnheiten – kurz: zwischen verschiedenen Welten hin und her zu wechseln.
“Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht.” – Konfuzius
Und es war eben diese Flexibilität, die es uns beiden in all den darauffolgenden Jahren ermöglicht hat, mit den schwierigsten oder verrücktesten Situationen klar zu kommen. Mit dem, was wir in unseren beschaulichen Heimatorten fürs Leben gelernt hatten, wären wir nicht weit gekommen. Die Regel aus dem Kindesalter haben wir um die Regeln, die wir im Großstadtdschungel gelernt haben, ergänzt: Bleib flexibel und offen für neues. Stelle viele Fragen. Versuche, die Situation mit anderen Augen zu betrachten.
Das sichert nicht nur das Überleben in asiatischen Megacities, sondern hilft auch erfolgreich verschiedene (berufliche) Situationen zu meistern.
[dropshadowbox align=“none“ effect=“lifted-both“ width=“auto“ height=““ background_color=“#ffffff“ border_width=“1″ border_color=“#dddddd“ ]
Die Autorinnen:
 Silke Irmscher ist interkulturelle Expertin, Trainerin und Expat-Coach und lebt mit ihrer multikulturellen Familie seit vielen Jahren in Indonesien.
Silke Irmscher ist interkulturelle Expertin, Trainerin und Expat-Coach und lebt mit ihrer multikulturellen Familie seit vielen Jahren in Indonesien.
 Susan Salzbrenner ist Beraterin im Bereich Organisationsentwicklung und Vielfalt & Inklusion, interkulturelle Trainerin und tingelt bereits seit 10 Jahren mit Kind und Kegel um die Welt.
Susan Salzbrenner ist Beraterin im Bereich Organisationsentwicklung und Vielfalt & Inklusion, interkulturelle Trainerin und tingelt bereits seit 10 Jahren mit Kind und Kegel um die Welt.
[/dropshadowbox]