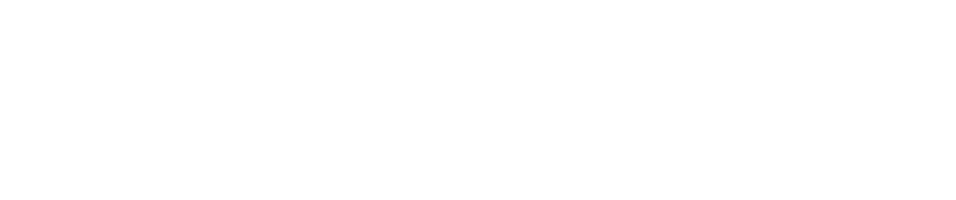„Die Menschen haben überall auf der Welt die gleichen Wünsche“
Paul Woods ist seit Jahrzehnten als Agraringenieur in der Entwicklungshilfe tätig. Im Interview erzählt er von seinen eigenen Wurzeln, brenzligen Situationen während seines Auslandseinsatzes und den Ursachen von interkulturellen Konflikten.
EXPAT NEWS: Ihre Nationalität ist britisch, Ihre Muttersprache aber niederländisch und Sie haben Ihren Abschluss als Agraringenieur der Fachrichtung Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus in Deutschland gemacht. Wie kam es dazu und woher rührt diese Multikulturalität bereits in jungen Jahren?
Woods: Mein Vater ist Brite, geboren in Croydon/England und kam 1923 als Baby zu einer Pflegemutter in die Niederlande. Meine Mutter ist ethnisch Sundanesin und wurde in Bandung West Java geboren. Die Sundanesen machen die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe Indonesiens aus. Als 12-jährige kam meine Mutter zu einer Pflegefamilie in die Niederlande. Das war 1936. Meine Eltern waren während des Zweiten Weltkrieges beide in deutscher Haft und wurden dort verheiratet, als deutlich wurde, dass meine Mutter schwanger war. Die Ehe wurde vom britischen Generalkonsulat in Amsterdam registriert und ich bin damit in eine britische Familie hineingeboren (1944-45). Das war in Amsterdam und ich bin dort auch zuerst eingeschult worden.
EXPAT NEWS: Aus welchen Beweggründen haben Sie sich für die Entwicklungshilfe entschieden?
Woods: Als Kind und Jugendlicher war ich „sozial entwurzelt“ und bin viel herumgekommen, jedoch selten freiwillig. So bin ich durch viele Pflegefamilien gereicht worden und habe zehneinhalb schlimme Jahre im Heim erlebt. Dadurch ist auch ein stark ausgeprägtes Misstrauen gegenüber Autoritäten und eine Solidarisierung mit unterdrückten Minderheiten entstanden, was einen wichtigen Teil meiner Persönlichkeit ausmacht. Bei der Entwicklungshilfe geht es darum, schwache Menschen so zu unterstützen, dass sie sich selbst helfen und weiterentwickeln, sich eine Existenz aufbauen können, die ihnen weitgehende Unabhängigkeit sichert.
Auch wenn der Anlass nie ein schöner war, so hat es mich während meiner Kindheit sehr gereizt, neue Orte, neue Länder zu sehen und kennenzulernen. Das wollte ich als Erwachsener fortsetzen. Nach meiner Ausbildung überlegte ich, welches Studium zu mir passt. Medizin stand im Raum, doch als jemand, der kein Blut sehen kann, hätte ich einen sehr schlechten Sanitäter abgegeben. Dann beschäftigte ich mich ein halbes Jahr mit Archäologie, stellte aber bald fest, dass die Arbeitsmöglichkeiten auf diesem Gebiet sehr rar gesät waren.
EXPAT NEWS: Was gab den Ausschlag für das Agraringenieurswesen?
 Woods: Ich sah das Studium als eine Kombination aus meinen Erfahrungen in der Landwirtschaft – durch meine Zeit im Heim – und aus meiner ersten Berufsausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel. Ein Professor, der an Regionalstudien in Indonesien beteiligt war, hat dann, als er feststellte, dass Niederländisch meine Muttersprache ist, vorgeschlagen, meine Abschlussarbeit über die Beschaffung von Fremdkapital für die Landwirtschaft in Indonesien zu schreiben. Er hat mir auch einen Zuschuss des DAAD beschafft, so dass ich finanzielle Unterstützung hatte.
Woods: Ich sah das Studium als eine Kombination aus meinen Erfahrungen in der Landwirtschaft – durch meine Zeit im Heim – und aus meiner ersten Berufsausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel. Ein Professor, der an Regionalstudien in Indonesien beteiligt war, hat dann, als er feststellte, dass Niederländisch meine Muttersprache ist, vorgeschlagen, meine Abschlussarbeit über die Beschaffung von Fremdkapital für die Landwirtschaft in Indonesien zu schreiben. Er hat mir auch einen Zuschuss des DAAD beschafft, so dass ich finanzielle Unterstützung hatte.
Als die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) auf mich aufmerksam wurde, waren sie begeistert. Sie müssen wissen, dass Indonesien lange unter der Kolonialherrschaft der Niederlande stand. Als deutsch und holländisch sprechender englischer Agraringenieur mit indonesischen Wurzeln war ich die ideale Besetzung für ein Wiederbepflanzungsprojekt von Kautschukbäumen.
EXPAT NEWS: Waren die ersten Jahre wie eine Rückkehr zu Ihren Wurzeln und haben Sie dort Ihre indonesische Identität gefunden?
Woods: Es war sehr aufregend für mich und eine tolle Erfahrung. Aber ich bin kein Indonesier. Das habe ich sehr schnell festgestellt. Ich kann mit der starken Religiosität und vor allem mit der ausgeprägten Unterwürfigkeit nicht viel anfangen. Von meiner Grundausrichtung bin ich dem westeuropäischen Kulturraum sehr verbunden; dieses Denken prägt meine Identität am Ehesten. Ich kann selten mit meiner Meinung hinterm Berg halten. Vor Kurzem saß ich mit drei Javanern und einem Amerikaner zusammen, als es um das Thema Rassismus in Indonesien ging. Sie müssen wissen, dass es zwar eine zunehmende Demokratisierung gibt, allerdings führen sich viele Javaner wie Kolonialherren über die Indonesier auf. Ich sagte, dass die Javaner gewiss keine Rassisten seien, sondern sich lediglich wundern, warum die Affen bekleidet sind und wer ihnen Morräder gegeben hat.
EXPAT NEWS: Seit Beginn Ihrer beruflichen Laufbahn haben Sie Station in unzähligen Ländern gemacht – vornehmlich solchen, die man als „Hardship Länder“, also als jene mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko, kennt. Um nur einige zu nennen: Indonesien, Uganda, Bangladesch, Botswana, Sierra Leone, Nigeria und Äthiopien. Wie gingen Sie und Ihre Familie mit dieser eigentlich omnipräsenten Gefahr um?
 Woods: Vielleicht fehlt mir ein „Risikobewusstsein“, aber außer in Uganda in den Jahren 1985 und 1986 habe ich kein Land als besonders bedrohlich oder risikoreich empfunden. Und meine Frau kam während des ugandischen Bürgerkrieges nach Entebbe/Kampala, um mich im Januar 1986 zu heiraten. Es war reiner Zufall, dass zu dem Zeitpunkt, da sie ihre Beurlaubung als Beamtin erlangte, in Uganda bereits der Wechsel zu Museveni erfolgt war und der Krieg beendet war, in dem Menschen ermordet, Frauen verschleppt und vergewaltigt wurden. Ein paar Mal bekam ich es schon mit der Angst zu tun. Ein Teamleiter nahm mich eines Tages in seinem Auto mit und im Kofferraum erblickte ich eine lange Stahlplatte.
Woods: Vielleicht fehlt mir ein „Risikobewusstsein“, aber außer in Uganda in den Jahren 1985 und 1986 habe ich kein Land als besonders bedrohlich oder risikoreich empfunden. Und meine Frau kam während des ugandischen Bürgerkrieges nach Entebbe/Kampala, um mich im Januar 1986 zu heiraten. Es war reiner Zufall, dass zu dem Zeitpunkt, da sie ihre Beurlaubung als Beamtin erlangte, in Uganda bereits der Wechsel zu Museveni erfolgt war und der Krieg beendet war, in dem Menschen ermordet, Frauen verschleppt und vergewaltigt wurden. Ein paar Mal bekam ich es schon mit der Angst zu tun. Ein Teamleiter nahm mich eines Tages in seinem Auto mit und im Kofferraum erblickte ich eine lange Stahlplatte.
EXPAT NEWS: Was hatte das zu bedeuten?
Woods: Diese fungierte als Schutz vor Kugelhagel. Was in Uganda in den Jahren des Bürgerkriegs vor sich ging und welche Folgen diese Katastrophe hatte, verglich ein deutscher Botschaftsmitarbeiter mit dem 30-jährigen Krieg. Ich finde das zutreffend. Wir waren froh, als unser Einsatz in Uganda beendet war und wir ausgeflogen wurden.
Ansonsten habe ich mich in all den anderen Staaten, die Sie als Hardship-Länder bezeichnen, selten bedroht gefühlt. Auch in Papua-Neuguinea, das wegen seiner hoher Gewaltkriminalität derzeit berüchtigt ist, hat sich meine Frau mit unserem ersten Kind frei bewegt. Wir hatten allerdings unseren Wohnsitz im Diplomatenviertel mit starker Bewachung und sind nachts nur sehr selten unterwegs gewesen.
EXPAT NEWS: Inwiefern und in welchem Ausmaß haben Sie in all den Jahren interkulturelle Konflikte erlebt und wie haben Sie diese gelöst? Gibt es aus Ihrer Sicht eine Art „Patentrezept“, wie interkulturelle Unterschiede bestmöglich überbrückt werden können?
Woods: Die Konflikte, die ich als persönlich erlebt habe, betrafen weniger die vielen Länder in denen ich lebte, sondern vielmehr mein direktes Umfeld. So sehe ich mich etwa oft als Vermittler zwischen den Niederlanden und Deutschland. Es ist für Deutsche oft schwierig, die unterschwelligen Empfindlichkeiten in den BeNeLux-Ländern zu bemerken und noch schwieriger sie zu verstehen. Beispielsweise muss ich Verwandten und Freunden in den Niederlanden immer wieder klarmachen, dass die heutige Generation in Deutschland – bis auf sehr kleine Gruppen – nicht für die Barbarei vor 1945 verantwortlich ist und sich deutlich davon distanziert.
Mit einigen meiner Verwandten habe ich deshalb keinen Kontakt mehr, weil ich es leid bin, meine deutsche Frau wegen der vergangenen Nazigräuel befragen zu lassen.
EXPAT NEWS: Durch ihre Arbeit haben Sie viele schlimme Konflikte gesehen beziehungsweise die Folgen grausamer Kriege erlebt und versucht, beim Wiederaufbau zu helfen. Aus Ihrer heutigen Sicht: Welche Hauptursache haben gewalttätige Konflikte zwischen Bevölkerungsgruppen?
Woods: Sie entstehen immer dann, wenn Minderheiten von Mächtigen massiv unterdrückt werden und die Mächtigen nicht einsehen wollen, dass auch andere Gruppen Rechte haben. Kommt dann noch eine offenkundige, mangelnde Bereitschaft hinzu, Privilegien zugunsten des Allgemeinwohls aufzugeben, begehren die Unterdrückten auf und es kommt zu Gewalteskalationen. In der Regel unterschätzen die scheinbar Überlegenen regelmäßig die Schwachen, wie die Geschichte gezeigt hat. Deshalb nützen kurzfristige Interventionen auf mittlere und lange Sicht gar nichts.
EXPAT NEWS: Es heißt oft, eigentlich seien alle Menschen gleich und die berühmte Ausstellung „Family of Man“ von Edward Steichen hat diese Aussage fotografisch untermauern wollen. Nach Jahrzehnten in der Entwicklungshilfe: Wie viel Wirklichkeit steckt tatsächlich in dieser Aussage?
Woods: Sie ist absolut zutreffend. Überall wo ich war, wollen die Menschen Frieden, Arbeit und ihre Kinder gut ausgebildete Erwachsene werden lassen. In dieser Hinsicht sind die menschlichen Grundbedürfnisse universal.
EXPAT NEWS: Hat Sie Ihre Tätigkeit in der Entwicklungsarbeit erfüllt, und konnten Sie viele Projekte realisieren?
 Woods: Ein Großteil der Projekte ist gescheitert und manchmal direkt gegen die Wand gefahren. So sollte ich beispielsweise für Nigeria ein Konzept erarbeiten, das für mehr Transparenz in der Finanzplanung der Bundesstaaten sorgt. Wenn diese Transparenz jedoch gar nicht gewollt ist, damit sich wenige die Taschen weiter vollmachen können und dies auch ungestraft geschieht, nützt das ausgeklügelteste Konzept nichts.
Woods: Ein Großteil der Projekte ist gescheitert und manchmal direkt gegen die Wand gefahren. So sollte ich beispielsweise für Nigeria ein Konzept erarbeiten, das für mehr Transparenz in der Finanzplanung der Bundesstaaten sorgt. Wenn diese Transparenz jedoch gar nicht gewollt ist, damit sich wenige die Taschen weiter vollmachen können und dies auch ungestraft geschieht, nützt das ausgeklügelteste Konzept nichts.
Meine Erfüllung habe ich darin gefunden, einzelne Menschen mit ihren Projekten zu fördern. Zurzeit unterstütze ich auf den Salomonen einen Einheimischen bei der Realisierung einer Reisplantage. Ich stelle Finanzierungskonzepte, bezahle beispielsweise Schulungen in Buchhaltung oder Anwälte, die Verträge daraufhin prüfen, dass der Neuunternehmer nicht ausgebeutet wird. Diese Unterstützung von Menschen und die Tatsache, dass sie mit meiner Hilfe ihr Potenzial ausschöpfen können, tragen oft viele Früchte. Ich möchte, dass Menschen mit schlechten Startbedingungen im Leben die Chance auf Autonomie haben.
EXPAT NEWS: Inwieweit hat sich Ihre Entwicklungsarbeit im Agrarbereich im Zuge der Globalisierung, so wie wir sie heute kennen, verändert?
Woods: Meiner Meinung nach hat es sie erschwert. Der Druck der Saatgut-, Dünger- und Pestizidhersteller auf der einen Seite und die Agrarlobby der USA und der EU auf der anderen Seite, aber auch von Brasilien auf die bäuerlichen Familienbetriebe in Afrika, Süd- und Südost-Asien ist deutlich wahrnehmbar. Dieser Druck manifestiert sich als Dominanz, vor allem einerseits beim Saatgut, andererseits aber auch bei den Märkten für Agrarprodukte, wobei sich auch Preistreiberei durch Spekulation negativ für Verbraucher, vor allem in ärmeren Ländern, auswirkt.
Zusätzlich ist seit Längerem ein Rückgang von ländlichen und landwirtschaftlichen Projekten zu verzeichnen, sei es bei der EU, der Weltbank und den regionalen Entwicklungsbanken, aber auch in der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit.
EXPAT NEWS: Können Sie sich vorstellen, sesshaft zu werden – im Sinne von einem Altersruhesitz?
Woods: Mein Altersruhesitz wird vermutlich der Ort, wo meine Frau herkommt. Das ist Neumagen-Dhron an der Mosel, wo wir seit 1986 gemeldet sind. Das Haus, in dem wir wohnen, ist seit annähernd 200 Jahren im Familienbesitz. Und ich halte mich gerne dort auf und kann mir tatsächlich vorstellen, dort langfristig zu bleiben. Mein Lieblingsland ist allerdings Indonesien, mit dem Essen, das ich liebe, den Nelkenzigaretten, die ich gerne rauche und der Dangdut-Musik.
EXPAT NEWS: Haben Sie „Universaltipps“ an Menschen, die – unabhängig von Ihrer Motivation – längerfristig ins Ausland gehen möchten?
Woods: Sie sollten sich für die erste Zeit, was aus meiner Sicht bis zu zehn Jahre sein könnten, ernsthafte Rückkehrmöglichkeiten offenhalten. Danach ist „der Zug meistens abgefahren“, das heißt, sie sind auch in ihrem Ursprungsland Fremde geworden. Zugleich sollten sie sich aber auf das Aufenthaltsland einlassen, also ernsthaft versuchen, sich zu integrieren und akzeptieren lernen, dass auch anderswo nicht alles perfekt ist. Wer sich von seinem Heimatland nicht richtig verabschiedet und mit dem Auswanderungsland nicht anfreunden kann, ist nirgends richtig verortet. Das Schlimmste was ich in dieser Hinsicht mal erlebt habe, waren zwei kleine Auswanderergruppen auf den Philippinen, einmal Schweizer und einmal Niederländer. Diese hatten kaum Anschluss an die einheimische Bevölkerung gefunden und verbrachten ihre Zeit damit, sich gegenseitig schlecht zu machen und zu bekämpfen. Keiner von denen wird jemals wirklich im neuen Leben ankommen.
Fotos: © Cmon – Fotolia.com; © V.R.Murralinath – Fotolia.com